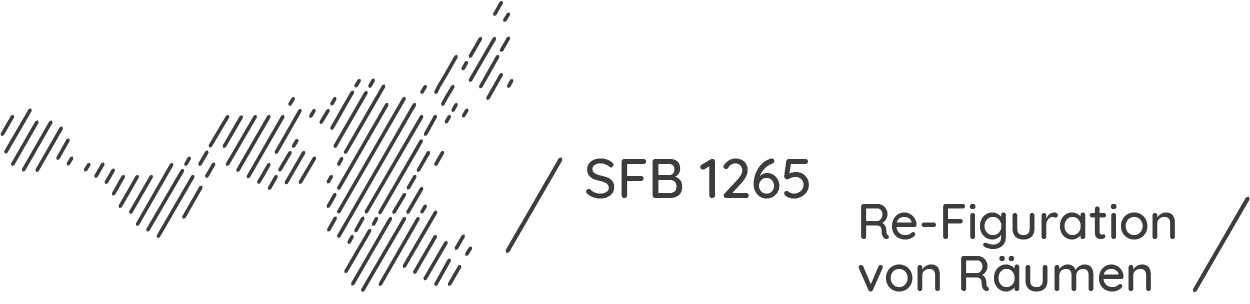Teilprojekte für die bewilligte dritte Förderphase (2026-2029)
Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1265 rückt die bislang vernachlässigte Rolle des Raums für den Prozess sozialen Wandels in den Mittelpunkt und untersucht die Um- und Neuordnung von Gesellschaft als Refiguration von Räumen. Die empirische Arbeit richtet sich auf die grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen seit den 1960er Jahren, die durch digitale Kommunikationstechnologien, Umbrüche der kapitalistischen Wirtschaftsweise, ökologische Krisen und nicht zuletzt durch Neuordnungen der politischen Geographie geprägt sind. In den ersten beiden Förderphasen hat es sich bewährt, von Refiguration im Singular zu sprechen, da wesentliche Aspekte des räumlich-sozialen Wandels nur als global vernetzt verstanden werden können. Empirisch manifestieren sie sich in Form neuer Figurationen und Raumanordnungen.
In der ersten Förderphase fokussierte der SFB auf die Erarbeitung theoretischer Grundlagen, die es erlauben, die qualitativen Merkmale neuer Raumanordnungen und ihrer prozessualen Herstellung zu beschreiben. Analytisch wurden vier Raumfiguren mit unterschiedlichen räumlichen Handlungslogiken und Ordnungsmustern identifiziert: Territorialraum, Netzwerkraum, Bahnenraum und Ort. Die zentrale Erkenntnis der ersten Phase war, dass Refiguration nur als Folge von Verbindungen, Spannungen und Konflikten zwischen den verschiedenen Raumfiguren zu verstehen ist.
In der zweiten Förderphase wurden die Raumfiguren konzeptionell zu topologischen Idealtypen weiterentwickelt und durch empirisch fundierte topographische Raumfiguren ergänzt. Durch eine konflikttheoretische Spezifizierung der empirischen Befunde konnte der SFB detailliert herausarbeiten, inwiefern sich viele gesellschaftliche Konfliktlagen auf Spannungen zwischen den Handlungslogiken der Raumfiguren zurückführen lassen. Varianten der Refiguration zeigten sich in divergierenden Bearbeitungsstrategien und Wissensordnungen sowie in sich verfestigenden Raumabhängigkeiten und Machtkonstellationen. Die beobachteten Raumdynamiken wurden zu drei thematischen Konfliktfeldern verdichtet: „Grenzen der Pluralisierung“, „Politiken der Infrastrukturierung“ und „Brüche der Ökologisierung“.
In der dritten Förderphase wird der SFB die empirischen Befunde zu einer Theorie der Refiguration synthetisieren, um daraus sowohl gesellschaftsdiagnostische Aussagen als auch Konsequenzen für Architektur und Stadtplanung abzuleiten. Die Forschungsarbeit gliedert sich weiterhin in die Projektbereiche „Raumwissen“, „Räume digitaler Mediatisierung“ und „Zirkulation und Ordnung“, die über den Figurationsbegriff zusammengeführt werden. Die empirische Fundierung der vier topologischen Raumfiguren soll die Basis für ein Modell zur Erklärung räumlicher Refigurationsprozesse bilden, zu dessen Überprüfung auch „abweichende Fälle“ herangezogen werden. Längs- und Querschnittsanalysen ermöglichen eine Systematisierung von Varianten der Refiguration. Auf diese Weise wird die empirisch fundierte Theorie der Refiguration abschließend ausformuliert.
Geplante Teilprojekte 2026-2029
-
A02 Raumwissen von Kindern: Hybride Raumpraktiken junger Menschen in Politik und Planung (Angela Million)
In der dritten Förderphase untersucht das Teilprojekt A02, wie sich das hybride Raumwissen von Kindern unter unterschiedlichen politischen und planerischen Rahmenbedingungen ausbildet. Bereits in der ersten Förderphase zeigte sich, dass traditionelle Aktionsraummodelle die komplexe Lebenswelt junger Menschen nur begrenzt abbilden, da digitale Medien verschiedene Raumlogiken überlagern. Die zweite Förderphase beschrieb die daraus entstehende Heterogenität jugendlicher Lebenswelten sowie hybride Raumpraktiken, in denen digitale und physische Raumnutzungen über mobile Endgeräte verknüpft werden.
In der dritten Förderphase analysiert das Teilprojekt, wie digitale Mediennutzung im Kindesalter das Raumwissen mitprägt und welche politischen und planerischen Maßnahmen diese hybriden Praktiken strukturieren. Dies umfasst u. a. digitale Bildungsprogramme, rechtliche und regulatorische Vorgaben, kommunale Aktionspläne sowie räumliche Planungen. Die Forschungsfragen lauten: (1) In welcher Weise rahmen politische und planerische Maßnahmen das digital geprägte Alltagshandeln junger Menschen, und inwiefern berücksichtigen sie deren aktuelle Raumkonstitutionen? (2) Wie erleben Kinder entsprechende Rahmenbedingungen und wie lassen sich ihre Praktiken mit dem Konzept der Raumfiguren beschreiben?
Methodisch wird die qualitative Metaanalyse der ersten Förderphase um Studien zum Raumwissen junger Menschen nach 2019 (Post-Corona) ergänzt und im Längsschnitt erweitert. Eine Fallstudie zu jungen Menschen in Shanghai betrachtet Raumpraktiken vor dem Hintergrund der dortigen Regelungs- und Planungsrahmens. Untersucht werden politische und planerische Maßnahmen, die das digital geprägte Alltagshandeln strukturieren, mit Fokus auf kinderfreundliche Kommunen und einschlägige Planungsinstrumente in Deutschland und China. Ziel ist keine Gegenüberstellung, sondern die Bandbreite von Politik- und Planungshandeln sichtbar zu machen, die die Refiguration des kindlichen Raumwissens prägt. Ergebnisse zur Refiguration sowie die WebApp „Maprepublic“ werden im Rahmen von Transferaktivitäten und Gestaltungsmodellen (siehe Teilprojekt D) für die Praxis aufbereitet. -
A04/C08 Architekturen des Asyls: Raumstrategien in der Auseinandersetzung mit Vertreibung und Klimastress (Philipp Misselwitz)
Das Teilprojekt A04 hat in der ersten Förderphase die subjektiven sozialräumlichen Aneignungspraktiken und home-making-Prozesse Geflüchteter und Binnenvertriebener in Berlin und Jordanien erforscht und sie als Teil konflikthafter Aushandlungen offengelegt, in denen unterschiedliche Wissensbestände hybridisiert werden. In der zweiten Förderphase wurden Geflüchtete und Binnenvertriebene in Berlin, Amman und Lagos als Mitgestalter*innen transskalarer Planungsregime untersucht, die mit städtischen Verwaltungen, nationalen Regierungen, multilateralen Organisationen und lokalen Mitbewohner*innen Teilhabe an urbanen Ressourcen aushandeln. Es wurde deutlich, dass Fluchtmigration als externer Schock die Refiguration von urbanen Planungsregimen beschleunigt. Hierbei können sozialräumliche Polarisierungen verstärkt, aber auch neue Möglichkeitsräume eröffnet werden.
In der dritten Förderphase wird das Projekt mit einer Erweiterung der Fallstudie in Lagos abgeschlossen. Untersuchungsgegenstand bleiben Handlungsstrategien vertriebener Menschen, deren Raumwissen nicht nur durch Herkunfts- und Asylort sowie Flucht geprägt ist, sondern auch durch Faktoren des Klimawandels. In ihren Rückzugsräumen entlang der Küstenzone von Lagos entwickeln sie eigenständig Schutzstrategien gegen Klimarisiken wie Meeresspiegelanstieg, Überschwemmungen oder Erosion. Beispielhaft hierfür sind Landreklamationsstrategien durch Müllaufschüttungen, die vor Wasserrisiken schützen und zugleich Siedlungsräume erweitern, wenn auch unter prekären Bedingungen. Die so entstehenden kritischen Zonen sind Teil einer sich dynamisch verändernden, konflikthaften Enklavenlandschaft, in der Vertriebene mit Fischerdörfern und hochpreisigen Siedlungsprojekten um Land, Ressourcen und Schutz ringen. Das Projekt verfolgt folgende Leitfragen: (i) Welche physisch-technischen Adaptationsstrategien an den Klimawandel lassen sich bei Geflüchteten und Binnenvertriebenen beobachten? (ii) Welche Wissenskonflikte entstehen dabei? (iii) Wie beeinflussen planerisches Handeln und Planungsdiskurse um „Klimaresilienz“ die Integration von Geflüchteten und Binnengeflüchteten oder anderen vulnerablen Gruppen in Lagos? Das Projekt untersucht Refiguration als einen von menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren geprägten Prozess, in dem die planetaren Krisen der Migration und des Klimawandels das Raumwissen entscheidend mitprägen. Es wird weiter multimethodisch mit Raumethnografien, Dokumenten- und visuellen Analysen sowie Interviews gearbeitet. -
A07 Naturräume: Konflikte um botanisches Wissen am Beispiel der (trans)atlantischen Wälder (Jamie-Scott Baxter/ Séverine Marguin)
Das neue Teilprojekt A07 untersucht Konflikte um das Wissen über Biodiversitätsschutz vor dem Hintergrund des dramatisch zunehmenden Aussterbens nicht-menschlichen Lebens auf der Erde. Der Naturschutz als paradigmatisches-modernistisches Regime, das historisch bestimmt hat, wie Menschen und nicht-menschliche Entitäten räumlich organisiert sind, wird seit den 1960er Jahren durch zeitgenössische Kräfte sowie sich verändernde klimatische Bedingungen, Dekolonisierungsbestrebungen (des Wissens) und Entwicklungen in der digitalisierten Biotechnologie massiv destabilisiert.
Das Teilprojekt fokussiert dieses existenzielle planetarische Problem aus einer räumlichen Perspektive in Bezug auf die fragmentierten transatlantischen Wälder, die sich entlang der von Imperialismus und kolonialer Expansion geprägten Küstenstreifen des Atlantischen Ozeans erstrecken, und untersucht die Refiguration von Räumen in diesem Kontext. Mit dem Ansatz einer interdisziplinären Designforschung zwischen Soziologie und Architektur, die eine multi-sited-ethnography mit Expert*inneninterviews und hybrid mapping kombiniert, untersucht das Teilprojekt, wie die transatlantischen Wälder und die Subjektivitäten von nature custodians (u. a Parkrangers, indigene Guaraní Leaders, IUCN-Mitarbeitende) in Raumkonflikten um Naturschutzwissen ko-konstituiert werden. Anhand der Beispiele Brasilien und das Vereinigte Königreich werden folgende Fragen untersucht: Welche Wissenskonflikte fordern die Stabilität des modernen Naturschutzregimes heraus? Und wie wirken sie sich auf die laufende Ko-Konstituierung von Naturräumen und die Subjektivitäten von Naturwächter*innen in transatlantischen Wäldern aus?
Das Problem des Biodiversitätsverlusts wirft nicht nur die Frage nach der Bedeutung des biologischen Wissens für den Naturschutz auf, sondern markiert zugleich auch eine soziopolitische und räumliche Frage sowie einen Machtkampf darüber, wer bestimmt, wie menschliches und nicht-menschliches Leben auf dem Planeten räumlich geordnet und neu organisiert werden. Durch die Untersuchung der Verräumlichung von Konflikten in Naturschutzregimen will das Teilprojekt aufzeigen, wie botanisches Wissen in Naturräumen materialisiert und reproduziert wird. Insgesamt zielt das Projekt darauf ab, Prozesse der Refiguration zu erfassen, in denen hegemoniale Epistemologien des Nordens durch vielfältigere Formen des Wissens (lokal, traditionell, subaltern, artisanal usw.) herausgefordert werden. -
B01 Digitales Planen und Arbeiten mit KI: Zur Konstruktion von Orten (Vivien Sommer/ Lech Suwala)
Das Teilprojekt B01 untersucht die Refiguration von Räumen im Kontext digitaler Planungsstrategien mit besonderem Fokus auf die Rolle von Künstlicher Intelligenz. Im Zentrum der dritten Förderphase steht die systematische Analyse der Raumfigur des Ortes und die Frage, wie durch Künstliche Intelligenz gestützte Planungsprozesse Ortsidentitäten prägen und verändern. Dabei rückt die Untersuchung der Räumlichkeiten von Künstlicher Intelligenz in den Vordergrund, verstanden als Zusammenspiel von algorithmischen Verfahren, planerischen Praktiken und sozialen Aushandlungsprozessen. Fallstudien in urbanen Kontexten wie New York und Lagos sowie in ländlichen Regionen Chiles verbinden qualitative Methoden wie Expert*inneninterviews und ethnografische Beobachtungen mit Sekundäranalysen aus den vorangegangenen Projektphasen und anderen Teilprojekten. Während die erste und zweite Förderphase die Grundlagen geschaffen haben, indem sie städtische und ländliche Räume im digitalen Wandel untersucht und Spannungsverhältnisse in der Konstruktion von Ortsidentitäten aufgezeigt haben, zielt die dritte Phase auf eine vertiefte theoretische und empirische Durchdringung der Rolle von Künstlicher Intelligenzen und der Systematisierung der Konstruktion von Ortsidentitäten in der Refiguration von Räumen ab.
-
B02 Outer Space: Satellitenkonstellationen als Herausforderung für den Netzwerkraum (Silke Steets)
Das Teilprojekt B02 untersucht die digitale Infrastrukturierung des Weltraums aus raumsoziologischer Perspektive und fokussiert dabei insbesondere auf die derzeit stark wachsende Zahl von Satellitenkonstellationen im Low Earth Orbit (LEO). Wir interessieren uns dafür, wie sich technisch vermitteltes kommunikatives Handeln im Weltraum räumlich figuriert, wie dieses Handeln durch Weltraumdiskurse und Raumimaginationen vorgeprägt ist und durch welche Governance-Strukturen sich das Feld des „NewSpace“ auszeichnet. Dazu setzen wir die in den ersten beiden Förderphasen durchgeführte empirische Forschung zur Räumlichkeit, Governance und Kontrolle von Räumen durch digitale Infrastrukturen fort.
Empirisch beleuchtet das Teilprojekt drei Ebenen: Erstens untersuchen wir das Kontrollhandeln in Satellitenkontrollräumen fokussiert-ethnografisch und vergleichen es mit dem kommunikativen Handeln in Kontrollräumen städtischer Infrastrukturen (Befunde aus der ersten Förderphase). Zweitens führen wir eine Governance-Analyse des derzeit massiv vorangetriebenen Ausbaus des Satelliteninternets durch staatliche, supranationale und private Akteure durch und vergleichen die Ergebnisse mit den Governancestrukturen des terrestrischen Internets (Befunde aus der zweiten Förderphase). Und drittens rekonstruieren wir die mit der Infrastrukturierung des Weltraums verbundenen Raumimaginationen, die wir mit jenen des Internetausbaus seit den 1990er Jahren vergleichen (Befunde aus der zweiten Förderphase).
Neben der allgemeinen Frage nach der Refiguration der digitalen Infrastrukturen verfolgt das Teilprojekt für den SFB das übergeordnete Ziel, die Raumfigur des Netzwerkraums empirisch wie konzeptionell zu bestimmen. Dazu blicken wir sekundäranalytisch im Längs- und Querschnitt auf eigene sowie andere im SFB erhobene Daten zur Funktionsweise (digitaler) Netzwerke und führen diese mit neu erhobenen Daten zusammen. Wir vermuten, dass sich durch die Erweiterung auf den Weltraum der „Surface Bias” der bisherigen Raumforschung überwinden lässt und so eine kritische Bestimmung der Netzwerkfigur möglich wird. -
B03 Multiple Einkapselungen: Gated Communities, Kunstenklaven und kinderfreie Räume (Martina Löw/ Jörg Stollmann)
In der ersten Förderphase des SFB 1265 hat das Teilprojekt die Refiguration von Räumen anhand der koreanischen smart city Songdo untersucht. Es zeigte sich, dass Refiguration dort in homogene Siedlungsformen und ein an den Interessen der Mittelschicht orientiertes Digitalisierungskonzept mündet. In der zweiten Förderphase konnte hergeleitet werden, wie mit der Durchsetzung dieser urbanen Apartmenthauspolitik als räumlicher Refiguration auch Protestbewegungen und alternative, queere Lebensformen entstehen. Wir beobachteten in beiden Förderphasen Strategien der Einkapselung der untersuchten Teilgruppen in digital kontrollierten, über Schwellen inszenierten Spezialräumen. Ziel der Einkapselungen ist es, Sicherheit vermeintlich zu erhöhen und Komplexität zu reduzieren. In der dritten Förderphase verfolgen wir das Ziel der Synthetisierung und Generalisierung der Ergebnisse. Wir stellen die Frage, wie baulich-räumliche und soziale Strukturen der Einkapselung sowohl dazu beitragen, Refiguration zu verarbeiten als auch in Form gesellschaftlicher Polarisierungen Refiguration weiter vorantreiben. Dies impliziert darüber hinaus die Frage nach der Porosität der Kapseln, erstens durch digitalisierte Vernetzung und zweitens über Dienstleistungen. Neben Sekundär-analysen vorliegender Daten und Querschnittsanalysen über verschiedene Teilprojekte im SFB sollen an zwei Phänomenbereichen vertiefende Erhebungen in Südkorea erfolgen: die Durchsetzung kinderfreier öffentlicher Räume in koreanischen Großstädten und die Förderung der Ansiedlung von Künstler*innen in peripheren Dörfern. Die Entwicklung von gated communities soll in Südkorea als Langzeitbeobachtung ebenfalls in der dritten Phase weitergeführt werden. Von der Untersuchung differenter und ähnlicher Formen der Einkapselung erwarten wir Aufschluss bezüglich ihrer Entstehungsbedingungen, der Art ihrer materiell-digitalen Schwellen und ihrer Relevanz. Ferner sind relationierende Erhebungen in Brasilien und in der Schweiz geplant. Das Teilprojekt verknüpft städtebauliche und soziologische Methoden. Eingesetzt werden teilnehmende Beobachtungen, hybrid mapping und leitfadengestützte Interviews.
-
B04 Lokative Medien: Google Maps als raumbezogene Infrastruktur (Ingo Schulz-Schaeffer)
Lokative Medien verkoppeln standortbezogene digitale Information mit dem physischen Raum zu neuen hybriden Formen und sind dadurch ein Treiber der Refiguration von Räumen. In der dritten Förderphase des SFB 1265 geht es in dem Teilprojekt B04 um lokative Medien in ihrer Eigenschaft als raumbezogene Infrastrukturen. Den empirischen Fokus bildet Google Maps, eine der derzeit weltweit wirkmächtigsten raumbezogenen digitalen Informationsinfrastrukturen. Google Maps ist die Grundlage einer Vielzahl von kommunikativen Handlungszusammenhängen und nimmt maßgeblichen Einfluss auf eine Vielzahl raumbezogener Regime und dementsprechend für Fragen der räumlichen Gestaltung von großer Bedeutung. Bereits dadurch, welche raumbezogenen Informationen Google Maps bereitstellt, nehmen Google Maps und seine Nutzer*innen gestaltenden Einfluss auf die Refiguration von Räumen, etwa indem diese Informationen die Sichtbarkeit bestimmter Orte, Bahnen-, Netzwerk- oder Territorialräume verändern. Zugleich können diese Informationen in vielfacher Weise für die planerische Gestaltung von Räumen genutzt werden.
Bei der Erforschung der Potenziale und Risiken nutzungsgenerierter raumbezogener Inhalte fokussiert das Teilprojekt anknüpfend an Forschungen aus der vorherigen Förderphase auf die (Un-)Sichtbarkeit der queeren Community und ihrer Orte, Territorialräume und Bewegungsmöglichkeiten und -grenzen im städtischen Raum. Bei der planerischen Gestaltung fokussiert das Teilprojekt auf Sicherheit und Zugänglichkeit. Hier geht es um die Nutzung von Google Maps-Daten für die planerische Herstellung bzw. Vermeidung von Zugänglich- oder Unzugänglichkeiten im städtischen Raum.
Das Projekt ist vergleichend angelegt. Es vergleicht einen urbanen Raum mit einer Tradition staatlich bereitgestellter Infrastrukturen als Kollektivgüter (Berlin bzw. Hamburg) mit einem stark sozial segregierten urbanen Raum, in dem Infrastrukturleistungen stark von privaten Anbietern bereitgestellt werden (Kapstadt). Methodisch kombiniert es semi-strukturierte Interviews, Dokumentenanalysen und ethnografische Ortsbegehungen. Durch die Untersuchung von Google Maps als einer im doppelten Wortsinn kritischen Informationsinfrastruktur leistet das Teilprojekt einen wesentlichen Beitrag für ein besseres Verständnis des digitalen Wandels und seiner Implikationen für das handlungsleitende Raumwissen von Akteur*innen. -
C01 Grenzen der Welt: Lokale Grenzregime in Konflikten um Abschiebung (Johanna Hoerning/ Steffen Mau)
Grenzziehungen und ihre Veränderung sind ein wesentlicher Teil gesellschaftlicher Raumfigurationen. Das Teilprojekt C01 hat in den bisherigen Förderphasen makrostrukturelle Dimensionen von Grenzen und Grenzkonflikten analysieren können. In der dritten Förderphase wenden wir den Blick auf Grenzkonflikte, die an konkreten Individuen und der Verortung ihrer Körper ansetzen. Diese werden besonders sichtbar in Konflikten um Abschiebungen, in denen nicht nur gesamtgesellschaftliche Konfliktlinien und territoriale Ausweisung greifen, sondern auch ortsspezifische Kollektivvorstellungen und Praktiken der Herauslösung aus lokalen Kontexten ausgebildet werden.
Abschiebungen lassen sich dabei dem Phänomen der flexibilisierten Grenzkontrolle oder der shifting borders zuordnen, bei dem Grenzkontroll- und Selektionspraktiken zunehmend jenseits der Grenzlinie ausgeübt werden. Das Teilprojekt untersucht dabei, zu welchen lokalen Konflikten diese räumlich wie zeitlich versetzen Praktiken der territorialen Sortierung führen. Über historische und aktuelle Fallanalysen lokaler Konflikte um Abschiebung wird die Refiguration der inneren Grenzziehung zum Gegenstand gemacht. Untersucht werden Konflikte um Abschiebungen in ländlichen und städtischen Kontexten Deutschlands und Australiens, die auf ein temporäres Aufenthaltsrecht folgen, und damit die Wirkung von Grenzpolitik auf Individuen, lokale Gemeinschaften und Verflechtungszusammenhänge. Dabei fragen wir, wann und wie Konflikte um Abschiebungen lokal wirksam werden, welche Kriterien darin verhandelt werden und wie sich beides seit den 1990er Jahren verändert hat. Das Projekt nimmt eine systematisch vergleichende und fallrekonstruktive Perspektive ein und erschließt historische und aktuelle Konfliktfälle um Abschiebung in Deutschland und Australien über einen qualitativen Methodenmix. Territoriale Grenzinfrastrukturen, regionale Grenzregime und die Verlagerung der Grenzsituation an Alltagsorte rekurrieren aufeinander, weshalb in der letzten Förderphase ein synthetisierender Vergleich der Grenzpraktiken und -konflikte auf der Basis aller drei Ebenen möglich wird. Damit bilden die drei Förderphasen eine komplementäre Struktur aus, welche die räumliche Refiguration der Grenzziehungen in einer Verknüpfung von Makro- und Mikroperspektive umfassend in den Blick nehmen lässt. -
C05 Das städtebauliche Mikroklimaregime: Wie elementare Kräfte städtische Klimaanpassungspolitiken prägen (Ignacio Farías)
Das in der zweiten Förderphase des SFB 1265 begonnene Teilprojekt C05 untersucht die Refiguration städtischer Räume im Kontext der Implementierung von Klimaanpassungsmaßnahmen, insbesondere durch sogenannte naturbasierte Lösungen. Der Fokus liegt auf der genealogischen und qualitativen Analyse der Erfassung, Mobilisierung und Politisierung materieller Elemente wie Luft, Wasser und Sonnenstrahlung. Ziel ist es, den aktuellen Diskurs zu naturbasierten Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Spezifik dessen, was als „elementarer Urbanismus“ (Farías & Kemmer, 2024) bezeichnet wird, herauszuarbeiten. In der bisherigen Förderphase wurden anhand zweier Fallstudien – Stuttgart und Fukuoka – die historischen und gegenwärtigen Formen des konvektiven Managements von Wärme erforscht. Dabei wurde untersucht, wie Wind, frische Luft und Ventilation auf Stadtebene (z. B. Kaltluftschneisen in Stuttgart) und auf Körperebene (z. B. Hi-Tech-Textilien in Japan) organisiert werden.
In der abschließenden Förderphase wird diese Perspektive auf zwei weitere Formen des elementaren Urbanismus erweitert: die Klimaanpassung durch Schatteninfrastrukturen und durch den Bau einer sogenannten Schwammstadt. Diese policy assemblages werden in Städten untersucht, die historisch und aktuell zentrale Orte für ihre Entwicklung darstellen. Die Datenerhebung erfolgt durch halbstrukturierte Interviews mit Akteuren insbesondere aus den Umweltwissenschaften, der Planung und Architektur, sowie durch eine umfassende Dokumentenanalyse. Die Forschungsfragen, die die abschließende Förderphase strukturieren, lauten: (i) Wie werden elementare Kräfte in aktuellen städtebaulichen Ansätzen und Techniken zur Klimaanpassung mobilisiert und in städtische Infrastrukturen integriert? (ii) Wie refigurieren „elementare Lösungen“ städtische Räume sowohl konzeptionell als auch materiell, indem sie bestehende Raumkonfigurationen problematisieren und transformieren? (iii) Welche genealogischen Ordnungen und translokalen Zirkulationen sind mit diesen „elementaren Lösungen“ verbunden, insbesondere in Bezug auf die Interaktion zwischen Umweltwissenschaften und Stadtpolitik? Die erwarteten Ergebnisse des Teilprojekts umfassen eine differenzierte Analyse des städtebaulichen Mikroklimaregimes. Durch die vergleichende Untersuchung der Elemente Luft, Wasser und Schatten wird der Diskurs um naturbasierte Lösungen kritisch erweitert, indem die Spezifik der mobilisierten Elemente und die damit verbundenen Raumfiguren vertieft untersucht werden. Das Projekt strebt eine enge Zusammenarbeit mit stadtpolitischen Akteuren an – insbesondere aus den Bereichen Planung und Architektur –, um die Relevanz und Anschlussfähigkeit der gewonnenen Erkenntnisse für die Praxis der urbanen Klimaanpassung zu fördern und praxisorientierte Impulse für zukünftige Planungen zu liefern. -
C07 Plattformökonomie: Von kommerzialisierten Orten zur algorithmischen Regulierung von Airbnb (Stefan Kirchner)
Das in der zweiten Förderphase des SFB 1265 begonnene Teilprojekt C07 untersucht die Refiguration von Räumen am Beispiel der digitalen Plattform Airbnb. Wissenschaftliche Debatten verorten Airbnb im Spannungsfeld zwischen ermöglichter Teilhabe durch Sharing-Praktiken und overtourism durch Kommerzialisierung. Vor diesem Hintergrund analysiert das Projekt das spezifische Wechselverhältnis zwischen Ort, Territorial- und Netzwerkraum, das den digitalen Marktplatz von Airbnb ausmacht. Die empirischen Ergebnisse aus der vorherigen Förderphase zeigen lokal unterschiedliche Kommerzialisierungsgrade und abweichende Ansätze lokaler Einhegung. Airbnb wird vor Ort teils geduldet, teils stark eingeschränkt. Weltweit gibt es vermehrt Fälle strengerer Regulierungen, die den Territorialraum gegen den Netzwerkraum von Airbnb behaupten wollen. Neben klassischen Ansätzen wie Verboten und Kontrollen wächst die Bedeutung algorithmischer Regulierung. Diese nutzt Plattformdaten, um den Territorialraum als Domäne wiederherzustellen, teilweise begleitet durch Proteste und Initiativen vor Ort. Die bisherigen Ergebnisse zeigen dabei das Wechselspiel von Netzwerk-, Territorial- und Ortsraum, das sich durch den Zugriff auf Plattformdaten substanziell verändert.
In der dritten Förderphase des SFB erweitert das Projekt daher systematisch die Varianz der Analysen und prüft, ob und inwieweit die bisherigen Ergebnisse auf weitere Tourismushotspots zutreffen. Dafür setzen (a) Korrespondenz- und Kontrastfälle die bisherigen qualitativen und quantitativen Erhebungen fort. Die verschiedenen Ausprägungen und Marktplatzdynamiken von Airbnb werden in einem Kontinuum von schwach bis stark regulierten Varianten vergleichend untersucht. Mit umfangreichen (b) quantitativen Langzeitbeobachtungen bildet das Projekt die Entwicklungen von Airbnb in seinen langfristigen Dynamiken ab. Dieses deckt die Raumanordnungen im Zusammenspiel mit Regulierungsregimes und der Kommerzialisierung der Angebote auf. In einer fokussierten Fallanalyse von (c) algorithmischer Regulierung untersucht das Projekt, wie sich Behörden und Initiativen (bspw. Nachbarschaftsvereinigungen) den Zugang zu Plattformdaten erschließen, um vor Ort mit Airbnb umzugehen. Das Projekt implementiert ein Mixed-Methods-Design, das umfangreiche quantitative Analysen von historischen Plattformdaten (Reviews und Angebote seit 2015 bis heute) mit kontrastierenden Fallstudien der administrativen Einhegungsversuche und Initiativen vor Ort kombiniert. Die erweiterte Fall-basis, die Langzeitbeobachtungen und die intensive Analyse der algorithmischen Regulierung zielen darauf ab, die These der Refiguration am Beispiel von Airbnb als Regime der Zirkulation und Ordnung exemplarisch zu prüfen. Der Fall Airbnb liefert damit mit der Refigurationstheorie fundierte Erkenntnisse, um Phänomene der Digitalisierung konzeptionell unterfüttert modellieren und erklären zu können. -
C09/A03 Warenketten: Zirkulation und Ordnung in Bahnenräumen (Nina Baur)
Über alle Förderphasen hinweg fragt das Teilprojekt C09 (in den ersten beiden Förderphasen als A03 geführt) aus wirtschaftssoziologischer und -geographischer Perspektive danach, wie Regime, objektivierte Infrastrukturen und Wissen die Zirkulation und Ordnung in Warenketten für Lebensmittel beeinflussen. Warenketten sind translokal organisierte, vertikal und horizontal verflochtene Interdependenzketten, die sich in drei Teilkontexte untergliedern: Produktion, Marktentnahme und Konsum. Da Warenketten aufgrund ihrer Komplexität schwer als Ganzes in den Blick genommen werden können, fokussierte das Teilprojekt zunächst auf die größte Forschungslücke: die Rolle von (Raum-)Wissen in Händler*innen-Konsument*innen-Interaktionen im Kontext der Marktentnahme. Am Beispiel von Berlin wurde ein empirisch begründetes Modell entwickelt (erste Förderphase), das schließlich mittels kontrastierender Städte (Nairobi, Singapur) überprüft wurde (zweite Förderphase). Das Teilprojekt zeigte, dass (a) Raumkonflikte zwischen Bahnenraum (Warentransport) und Territorialraum (Marktabgrenzung) in Warenketten inhärent angelegt sind und (b) durch Nichtwissen aufgelöst werden. (c) Objektivierte Infrastrukturen und Regime ermöglichen die Aufrechterhaltung der Warenzirkulation.
In der dritten Förderphase sollen die bisherigen Befunde zu einem prozessualen Erklärungsmodell der Refiguration in verschiedenen Varianten des Bahnenraums am Beispiel der Zirkulationsordnung von Warenketten synthetisiert werden. Ziel des Teilprojekts ist es darüber hinaus, die Relevanz und Refiguration von Bahnenräumen in und durch Wirtschaftsprozesse im Längsschnitt zu rekonstruieren sowie die Varianz und Variabilität der Eigenschaften (re-)produzierter Bahnenräume herauszuarbeiten. Kernstück der Analyse sind Warenketten für Äpfel mit unterschiedlichen Wandlungsdynamiken (2019–2029): eine kurze stabile (Deutschland → Berlin), eine stabile lange (Südafrika → Berlin), eine neue lange (Deutschland → Thailand) und eine komplett umstrukturierte lange Warenkette (Chile → Berlin zu Chile → Lima). Diese werden mit drei Kontrastfällen mit anderen Produkteigenschaften verglichen: schwarze Buntbarsche (Thailand → Bangkok), Wolle (Südafrika → Berlin) und grüner Wasserstoff (Chile → Deutschland). Methodologisch werden im Rahmen eines Fallstudiendesigns die Methoden des Value Chain Mappings und der Verlaufsmusteranalyse kombiniert. Aufbauend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Förderphasen leistet das Teilprojekt einen wesentlichen Beitrag zur Ausarbeitung der Raumfigur des Bahnenraums und verbindet exemplarisch idealtypisches Erklären mit prozessorientiertem Erklären. Gemeinsam mit Kooperationspartner*innen aus dem Globalen Süden verfeinert das Projekt exemplarisch die in den ersten beiden Förderphasen entwickelten Konzepte zur Dekolonialisierung der Methodologie der Sozialwissenschaften (dezentrierte Fallauswahl, kollaborative Forschung, ethnografisches Gegenlesen). -
D Verstehen – Erklären – Gestalten: Theorie und Praxis der Refiguration (Martina Löw/ Séverine Marguin/ Silke Steets)
Das neue Teilprojekt D, das keinem Projektbereich zugeordnet ist, übernimmt konzeptionelle Querschnittsaufgaben für den SFB 1265. Doppeltes Ziel des Teilprojekts ist es, (1) im engen Wechselspiel mit dem Gesamtverbund ein raumtheoretisch fundiertes Modell verstehenden Erklärens zu entwickeln und dieses (2) mit einem Gestaltungsmodell zu verbinden, das die Erkenntnisse des SFB für die Planungspraxis zugänglich macht.
Das zu entwickelnde Modell verstehenden Erklärens baut auf dem Verstehen räumlicher Sinn- und Handlungszusammenhänge auf und folgt der interpretativen Methodologie, die den SFB insgesamt prägt. Es soll sozialwissenschaftliche Formen des Erklärens, die in der Regel auf die zeitliche Abfolge von Ereignissen gerichtet sind, um eine raumtheoretische Perspektive erweitern und so methodeninnovativ wirken. Sein Ausgangs- und Bezugspunkt bildet die Raumfigurenanalyse. Über geteilte Arbeitsschritte wird parallel zum Erklärungsmodell ein Gestaltungsmodell entwickelt, das ebenfalls an die Raumfigurenanalyse anschließt. Es soll Akteure aus der räumlichen Praxis in die Lage versetzen, die Refiguration von Räumen planerisch mitzugestalten. Dafür werden spezifische Instrumente entworfen, die auf den methodischen Vorarbeiten des SFB aufbauen. Beide Modellbildungen sind so konzipiert, dass sie wechselseitig voneinander profitieren: Das Erklärungsmodell liefert wichtige grundlagentheoretische Erkenntnisse für das Gestaltungsmodell; umgekehrt wird das Gestaltungsmodell auch zur Theorieentwicklung beitragen, indem es frühzeitig zentrale Einsichten des SFB mit der planenden und bauenden Fachöffentlichkeit diskutiert und so Rückkopplungseffekte erzeugt, die für die Verfeinerung der theoretischen Konzepte fruchtbar gemacht werden. Sozialwissenschaftliche Theoriebildung erfolgt somit praxisnah, Planung, Gestaltung und Bauen (raum)theoriegeleitet. Das Teilprojekt nutzt die besondere Interdisziplinarität des SFB aus Sozial- und Planungswissenschaften/Architektur für die Synthese seiner Befunde. -
WIKO Archiving Refiguration – Refiguring the Archive (Stefanie Bürkle/ Silke Steets)
Das Teilprojekt Wissenschaftskommunikation (WIKO-Projekt, in den ersten beiden Phasen: Ö-Projekt) zielt auf die Vermittlung der Arbeit des SFB 1265 und seiner Ergebnisse durch künstlerische Arbeit ab. Dabei folgt es den Prinzipien einer selbstreflexiven Wissenschaftskommunikation. Durch die gemeinsame Leitung des WIKO-Projekts durch eine Wissenssoziologin und eine bildende wird die bereits in den ersten beiden Förderphasen etablierte Kooperation zwischen wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeitsweisen intensiviert. Hauptziel dieser Kooperation ist der Aufbau eines umfassenden multimodalen Archivs der Refiguration.
Archive sind keine neutralen Repräsentationen von Materialsammlungen, sondern codieren, sortieren und transformieren das in ihnen Aufbewahrte auf je spezifische Weise. Archive sind somit sedimentierte Wissensordnungen und bilden zugleich die materielle Grundlage gegenwärtiger und zukünftiger gesellschaftlicher Denkprozesse. Debatten kritischer Archivforschung aufnehmend, wird das multi-modale Archiv der Refiguration die während der Laufzeit des SFB in Kooperation mit weltweiten Partner*innen gesammelten Befunde in Bild-, Video-, Ton- und Textdaten so ordnen, dass es die Arbeit des SFB langfristig dokumentiert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Zugleich soll es als kritische Ressource für zukünftige Raumforschung dienen. Wichtige Bestandteile des Archivs werden auch die im Rahmen der künstlerischen Forschung der vorherigen Phasen des WIKO-Projekts entstandenen Bilder und Materialien sowie eine fotografische Langzeitbeobachtung Berlins von der Teilprojektleiterin Stefanie Bürkle sein. Diese werden in Begriffen der Refiguration re-analysiert, neu sortiert und archiviert und treten in einen spannungsreichen Dialog mit den Befunden des SFB. Eine speziell programmierte Website bildet das gesamte Archiv in verschiedenen Medien ab; seine Architektur folgt der medialen Übersetzung zentraler Begriffe der Refiguration (Raumfiguren, multiple spatialities, Polykontexturaltität etc.). Das Archiv wird von zwei Publikationen begleitet, dem auf Englisch publizierten Buch Exploring the Refiguration of Spaces (Silke Steets), das das Archiv durch konzeptionelle und methodologische Reflexionen rahmt und eine internationale akademische Öffentlichkeit adressiert, sowie Stadt als gebauter Wissensraum, ein künstlerisches Archiv der Refiguration von Räumen (Stefanie Bürkle/Doktorandin), das sich an eine breitere kunst- und stadtrauminteressierte Öffentlichkeit richtet.